Der leere Raum
Michael Seibel • Ästhetik: Zur Arbeit von Peter Brook (Last Update: 15.05.2014)
Wir sind dabei, einen philosophischen Begriff von Ästhetik zu
erarbeiten. Und wir sind dabei ganz am Anfang. Nicht ganz natürlich.
Selbstverständlich ist uns bewusst, dass sich ein Kunstbegriff heute
nicht mehr auf ein auch nur im mindesten allgemeingültiges
Konzept der Schönheit mehr stützt und schon gar nicht auf
bestimmte Abbildungsideale. Aber diese begründete Skepsis lässt
sich nicht so ohne weiteres durch einen besseren Kunstbegriff füllen.
Kann es heute überhaupt noch einen sinnvollen Begriff von
Ästhetik geben? Das ist unsere Frage.
Ein herrlich universeller Satz von Peter Brook hat unser Interesse erregt
und ist ein Kandidat dafür, ein interessanter Ansatzpunkt für
die Frage nach dem Ästhetischen zu sein:
„Ich
kann jeden leeren Raum nehmen und ihn eine nackte Bühne nennen.
Ein Mann geht durch den Raum, während ihm ein anderer zusieht;
das ist alles, was zur Theaterhandlung notwendig ist.“
(Peter Brook, der leere Raum, Berlin 1983, S.9)
Der
Satz ist umso vielversprechender, als die Szenerie, die er vor uns
hinstellt, ubiquitär ist. Jeder Ort kann Bühne sein. Und
ist es wohl auch ganz alltäglich. Wenn es ständig um ein
Geschehen geht, das Räume füllt, dann ist prinzipiell
alles, was wir von morgens bis abends tun, jede Füllung des
Raumes unter den Augen des Anderen ästhetisch beschreibbar,
sowohl im Alltag wie in explizit künstlerischen Produktionen.
Genau
das tun wir ja ständig: wir füllen Räume mit dem aus,
was wir tun und setzen uns dabei dem Widerspruch und Zuspruch der
anderen aus.
Nur
kommt es uns nicht so vor, als sei das Theater. Wir unterscheiden
berufliche Rollen, familiale Rollen und sehr viel mehr.
Aber
was wäre der Unterschied, ob man einen Raum und die ihn
füllenden Geschehnisse in ästhetischen Kategorien oder in
nicht ästhetischen Kategorien beschreibt? Gibt es Spezifika
einer ästhetischen Beschreibung?
Nun
sind wir um Beschreibungen in Termen von Ästhetik keineswegs
verlegen. Geschmacksurteile sind in der Regel ganz leicht zu fällen.
Nur leider sind sie auch uns selbst schwer verständlich. Warum
urteilst du, wie du urteilst? Wie kommst du darauf?
Folgen
wir Brook und beginnen wir das Nachdenken über Ästhetik
nicht mit dem Begriff Schönheit, sondern wie er mit dem
Begriff Lebendigkeit, bzw. dessen Gegenteil Tödlichkeit.
Brook
hatte gefragt: Was führt dazu, dass es Theateraufführungen
gibt, die tot wirken?
Ob
das der Fall ist, kann man seiner Meinung nach unmittelbar erleben.
Alle,
die am Theater teilnehmen, das Publikum, die Schauspieler und ebenso
der Regisseur erleben unmittelbar, ob eine Aufführung tot wirkt
oder nicht. Nur – und das sagt er ausdrücklich –
haben wir kein eindeutiges Kriterium, wann etwas tot ist, so wie es
ein Arzt hätte, wenn es um einen Körper geht. Es gibt nicht
nur keine allgemein brauchbaren, eindeutigen Kriterien, sondern es
gibt, so Brook, Situationen, in denen z.B. Zuschauer gerade totes
Theater besonders angenehm finden. Er meint, das sei gerade dann der
Fall, wenn sie einfach das sehen wollen, woran sie bisher schon am
meisten gewöhnt sind.
Das
Leben und Tod eines Theaterstücks sind sozusagen evident, aber
diese Evidenz ist nicht allgemein verbindlich.
Die
Möglichkeit, sich darüber zu unterhalten, was eine
bestimmte Aufführung zu einer toten Angelegenheit macht, scheint
auf die Teilnehmer am Theater beschränkt, die die grundlegende
Erfahrung überhaupt teilen, es mit etwas Toten zu tun zu haben.
Der
Unterschied zwischen lebendig und tot in Bezug auf Inszenierungen
bleibt auch für Brook trotz seiner jahrzehntelangen intensiven
Beschäftigung damit überraschend, nicht abschließend
beschreibbar. Was am Ende tot und was lebendig innerhalb einer
einzelnen Theatervorstellung sein wird, ist auch für den
Regisseur unvorhersagbar. Brooks Arbeit findet sich damit jedoch
keineswegs ab. Es scheint Faktoren zu geben, die Anteil am Gelingen
haben. Manchmal, nicht immer.
Dabei
scheint die Aufmerksamkeit des Publikums eine Art Messinstrument
dafür zu sein, was lebendig und was tot in der Darstellung ist.
Brook
gibt reichhaltige Beispiele für überraschende Erfahrungen
vom Gelingen und Misslingen von Darstellungsversuchen und ganzen
Aufführungen ein und des selben Stücks mit ein und den
selben Schauspielern, kaum dass sich Rahmenbedingungen am
Aufführungsort ändern.
Ganz
offenbar hätte es keinen Zweck, möglichst alle
Rahmenbedingungen zu notieren, um so Misserfolge zu vermeiden.
Wiederholbare Erfolge scheinen so nicht herstellbar zu sein.
Von
einem Ingenieur würde man reproduzierbare Ergebnisse erwarten.
Aber von einem Künstler auch? Wie ein bestimmtes Autozubehörteil
zu konstruieren ist, damit es langlebig seinen Zweck erfüllt,
steht so wenig in einem Lehrbuch wie das, was gute Regiearbeit
ausmacht, sondern muss erfahrungsmäßig entwickelt werden.
Man erwartet von Ingenieur dann aber ein sicher reproduzierbares
Ergebnis. Was ist es demnach eigentlich, was ein Regisseurn durch
Erfahrung lernt?
Hier
liefert Brook Beobachtungsarbeit aus künstlerischer
Berufserfahrung. Sicher scheint: Der Schauspieler nutzt Gesten, wenn
er etwas darstellen will, also muss er möglichst souverän
Gesten erzeugen können. Der Schauspieler spricht, wenn er etwas
darstellen will, also muss er sein Sprechen möglichst souverän
einsetzen können. Der Schauspieler bewegt sich, also muss er
seine Bewegungen bewusst steuern können. Brook vergleicht
Schauspieler und Pianisten auf dieser Ebene. Der Vergleich des
technischen Könnens fällt bei ihm stark zu Ungunsten der
meisten Schauspieler aus. Welche Techniken werden im einzelnen
gebraucht und welche nicht? Um zeitgemäß malen zu können,
sind die technischen Fähigkeiten alter Meister wahrscheinlich
nicht erforderlich. Sind denn die selben Fähigkeiten von einem
Schauspieler erforderlich, die um 1900 ein Stanislawski von seinen
Schauspielern erwartet hätte oder nicht (auch) ganz andere, mit
denen Stanislawski nicht viel hätte anfangen können?
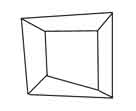
„Die
Technik des Inszenierens, Entwerfens, Sprechens,
Über-die-Bühne-Gehens, Sitzens selbst Zuhörens —
wird einfach nicht genügend beherrscht“.
(Peter Brook, der leere Raum, Berlin 1983, S.42)
Aber
kann sie je genug beherrscht werden? Was hieße es denn, sie zu
beherrschen?
„Man
muß sich aber vergegenwärtigen, daß ein permanentes
Ensemble zur Tödlichkeit verdammt ist, wenn es ohne Ziel und
daher auch ohne Methode und daher ohne Schule existiert. Mit Schule
meine ich selbstverständlich keine Turnhalle, wo der
Schauspieler besessen seine Glieder übt. Das Muskelbeugen allein
kann keine Kunst entwickeln, Tonleitern machen nicht den Pianisten,
und Fingerübungen helfen nicht dem Malerpinsel; und doch spielt
der Pianist viele Stunden am Tag Fingerübungen, und japanische
Maler üben ihr Leben lang das Zeichnen eines vollkommenen
Kreises. Die Schauspielkunst stellt in mancher Hinsicht von allen
Künsten die höchsten Anforderungen, und ohne ständige
Schulung wird der Schauspieler auf der Mitte des Weges
stehenbleiben.“
(Peter Brook, der leere Raum, Berlin 1983, S.40)
Was
verspricht der Regisseur, da er doch nicht über reproduzierbare
Erfolgsparameter verfügt, eigentlich den von ihm angeleiteten
Schauspielern? Woher nimmt er „Ziel“, „Methode“,
„Schule“, „Kompetenz“ über das Training
technischer Fertigkeiten hinaus?
Besetzt
der Regisseur da nicht einfach ein Leerstelle, die auch er nicht
füllen kann?
Am Ende wird der Schauspieler in jeder einzelnen Sekunde genau eine
einzige, jeweils vollständig bestimmte schauspielerische
Leistung abliefern. Er wird das zu sehen geben, was er eben zu sehen
gibt, sei es dürftig oder perfekt. Es wird keine Freiheitsgrade
im Sichtbaren mehr geben. Es wird Zuschauer geben, deren Imagination
und deren jeweiliger Sinnhintergrund noch einmal weiter das Gesehene
zu jeweils einem bestimmten Erleben im Theater präzisieren
werden. Im Erleben wären dann sozusagen auch alle Freiheitsgrade
des Imaginären kurzzeitig aufgehoben. Schauspiel und Zuschauen
öffnen sich natürlich sogleich in der nächsten Sekunde
für weiteres, möglicherweise Überraschendes.
Es
scheint unter dem Aspekt von Ästhetik um den gesamten
(künstlerischen) Prozess, angefangen beim leeren Raum (bei A),
angefangen bei der völligen Unbestimmtheit, die sozusagen
ausschließlich aus Freiheitsgraden besteht, bei einem Zustand,
in dem noch nichts entschieden ist, bis hin zur vollständigen
Bestimmtheit des Werks, der Aufführung ohne jeden noch
verbliebenen Freiheitsgrad im Gezeigten (B) wie selbst in der
Imagination (C) zu gehen. Der Künstler wird zeigen, was er eben
zeigt und der Zuschauer erleben, was er eben erlebt.
Die
künstlerische Arbeit wäre dann der Weg von A nach B. Die
Unterscheidung von Lebendigkeit und Tödlichkeit als erlebbare
würde jenseits davon (in C) vollzogen.
Auf
dem Weg von A nach B werden Freiheitsgrade ausgeschlossen.
Welches
Stück soll zur Aufführung kommen? Nehmen wir ein
Shakespeare-Drama. Damit sind alle anderen möglichen Texte
ausgeschlossen. Die Freiheit, was im leeren Raum passieren wird, wird
kleiner, die Bestimmtheit nimmt zu. Das Stück wird
interpretiert, Schauspieler werden ausgewählt und geschult. Eine
Szenerie wird geschaffen, Details werden erarbeitet. Am Ende wird ein
Schauspieler mit leichter Grippe an einem Stadttheater einen Monolog
vor einem bestimmten Publikum sprechen. In diesem Augenblick sind
alle Freiheitsgrade geschlossen.
Hier
kann etwas passieren oder auch nicht:
„Es
gibt auch Säulen der Bestätigung. Das sind die Augenblicke
der Erfüllung, die sich einstellen, plötzlich und irgendwo,
die Ereignisse, bei denen kollektiv ein totales Erlebnis, ein totales
Theater aus Stück und Publikum Aufteilungen wie tödlich,
derb und heilig zum Unsinn reduziert. In diesen seltenen Augenblicken
sind das Theater der Freude, das der Katharsis, der Feier, der
Forschung, des gemeinsam erlebten Gehalts und das lebendige Theater
ein und dasselbe.“
(Peter Brook, der leere Raum, Berlin 1983, S.199)
Brook
annonciert ein Gelingen, das dann vielleicht doch mit einem gewissen
Recht Schönheit zu nennen wäre. Und das scheint mir
zentral: Im Gelingen beginnt etwas. (Hermann Hesse: „und
jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“. An Hesse hat Brook
vielleicht zu allerletzt gedacht. Obwohl, Ende der 60er Jahre weiß man das nie so genau ...))
Aber
eben dorthin will man im künstlerischen Prozess ja erst einmal
kommen. Eben dazu wird der „leere Raum“ mit Bestimmungen
angefüllt.
Brook betont sehr stark den Herausforderungscharakter, der konzeptuelle
Stringenz und spontane Reaktion zugleich verlangt. Und
jede einzelne Bestimmung muss die Regie zumindest hypothetisch
begründen können. Woher nimmt sie ihre Begründungen?
Offenbar nicht aus Wiederholbarkeit.
Irgendwie
kommt mir der berühmte Satz aus Francis Ford Coppolas Film „der
Pate“ in den Sinn: „Wir werden ihm ein Angebot machen,
das er nicht ablehnen kann.“ Wenn man nicht wüsste,
dass der Satz im Film eine Ankündigung mafiösen Terrors
darstellt, könnte das eine Maxime des Boulevard-Theaters im
Umgang mit seinem Besucher abgeben, aber keine, die für Brook in
Frage käme.
weiter ...
Ihr Kommentar
Falls Sie Stellung nehmen, etwas ergänzen oder korrigieren möchten, können sie das hier gerne tun. Wir freuen uns über Ihre Nachricht.

