Lebendig oder tot?
Die Seele
Michael Seibel • Wie das Gehirn Klavierspielen lernt (Last Update: 08.01.2015)
Protokoll vom 17.12.2014
Ich möchte unsere Einführung zum Begriff der Seele
etwas vertiefen.
Wir
sagten: ›Seele‹, die griechische Übersetzung ist
psyche, die lateinische anima, ist bei den alten Griechen
der Begriff für das, was einen lebendigen Organismus von
einem Leichnam unterscheidet.
Man
dachte, die Seele sei der Träger von Lebensvermögen wie
Wachstum, Wahrnehmung, des Fühlens und Begehrens, des Denkens
und Wollens und kam von alters her zu ganz unterschiedlichen
Positionen in der Frage, ob die Seele sterblich ist oder nicht. Und
auch die Frage, wie man sich die konkrete Verbindung von Leib und
Seele vorzustellen habe, war immer strittig. Ist die Seele, die
Psyche nur ein Epiphänomen des Leiblichen oder ist sie im
Gegenteil etwas Immaterielles, was das materielle Leben allererst
bewirkt?
Wie
das im Einzelnen auch gesehen wurde: über das
Leib-Seele-Problem haben sich bereits die Vorsokratiker Gedanken
gemacht. Materialisten waren dabei wie Leukipp oder Demokrit. Für
sie war die Seele etwas besonders fein strukturiert Körperliches.
Daraus folgt die Endlichkeit und Sterblichkeit der Seele.
Platon
ist hingegen Dualist. Für ihn ist die Seele etwas
Nichtkörperliches. Ihr gegenüber steht das Materielle in
seiner Vielfalt. Die Seele ist dasjenige, was Einheit und Leben in
die Materie bringt. Weil die Seele das Prinzip der Einheit ist,
sollte man nach seiner Meinung die Seele auf keinen Fall mit sich
selbst uneins machen und mit Zwietracht belasten. Wer also
wissentlich Unrecht tue, zerstöre seine unsterbliche Seele, dies
auch ohne besondere göttliche Gebote.
Für
Platon ist die Seele unsterblich, da sie das Prinzip des Lebens ist.
Würde das Prinzip mit dem konkreten Leben sterben, wie sollte
dann neues Leben möglich sein? Es müsste dann ja doch
allein aus der Materie hervorgehen, und das eben hält Platon für
nicht möglich.
Die Unsterblichkeit der Seele bei Platon ist also nicht gegeben wegen
ihrer Gottesebenbildlichkeit wie im Christentum oder aus anderen
religiösen Motiven, sondern weil er dem Gedanken gerecht werden
will, dass das Leben etwas absolut irreduzibles auf tote Materie ist.
(Gibt es Gründe, warum wir auch heute noch diese Irreduzibilität
behaupten müssten?)
Einerseits denkt Platon die Seele als einfaches, nicht zusammengesetztes Wesen.
Andererseits als Träger heterogener, einander widerstreitender
Vermögen wie des Begehrens, des Streites und des Denkens. Allein
die Einheit der Seele garantiert die Einheit des Menschen als Person.
Das vermag nur die Seele und nicht der Körper und deswegen
zerstört sich selbst, wer schlecht handelt, weil er eben die
Seele in Widerstreit mit sich selbst bringt. Und weil der Leib keine
Rolle bei Platons Erklärung der Einheit der Person spielt, nimmt
Platon die vollständige Unabhängigkeit der Seele vom Leib
an.
Dagegen
haben wir die Position von Aristoteles abgesetzt. Aristoteles
kritisiert, dass Platon wie dessen Lehrer Sokrates das Physische zu
Unrecht gering schätze und daher das Verhältnis von Leib
und Seele nicht angemessen denken könne. Die Seele müsse
richtigerweise als Form (eidos) und erste Wirklichkeit
(entelecheia) der lebendigen Substanz (ousia) mit dem
Leib als Materie (hyle) zusammengedacht werden. Wirkliches
Leben sei immer Einheit von Stoff und Form (Hylemorphismus). In
dieser Einheit ist die Seele als Träger von Lebensvermögen
aktiv, wird nicht von der Materie bewegt, sondern bewegt sich selbst.
Die platonische Version des Begriffs der Seele folgt also einer eher
ethischen Intention, die aristotelische versucht eher eine allgemeine
Ontologie des Lebendigen zu liefern.
Aristoteles denkt dabei eine Stufenfolge niederer und höherer
Seelenvermögen, die vegetativen Seelenvermögen des
Stoffwechsels und des Wachstums, gefolgt von den animalischen des
Wahrnehmens, Begehrens, des Gedächtnisses und der Phantasie, der
Selbsterhaltung bis hin zu den höchsten des Denkens und Wollens.
Aus der Ordnung der Seelenvermögen leitet sich dann bei ihm eine
Hierarchie des Lebendigen ab, das Reich der Pflanzen, Tiere und
Menschen.
Jetzt
ein anderer Aspekt des Themas 'Seele' vom letzten Treffen:
Eine
grundsätzliche Bemerkung zum philosophischen Status der
gegenwärtigen Neurowissenschaften (Stichwort Gerhard Roth
„Wie das Gehirn die Seele macht“, ich habe es
bisher nicht gelesen und getraue mich dennoch, folgende kleine
Geschichte zu erfinden:)
Man
denke an eine junge Frau, die dabei ist, Klavier zu lernen. Sie gibt
sich die allergrößte Mühe und ist ganz besonders
talentiert. Ihre Eltern, Sponsoren oder wer auch immer wollen ihr das
Maximale bieten, um ihr Talent voll zu entwickeln. Nun haben sie
davon erfahren, dass die Neurowissenschaften in der Lage sein sollen,
mittels bildgebender Verfahren recht genau und in Zukunft immer
genauer zu verfolgen, ob sich in bestimmten Hirnarealen durch das
Üben neue Synapsenverbindungen bilden, die für den
Lernfortschritt charakteristisch sind. Mehr noch; man sei auf diese
Weise sogar dahin gelangt, bestimmte neurologische Defizite
behandelbar zu machen, die bei manchen Pianisten im Laufe ihres
späteren Bühnenlebens auftreten könnten.
Sie
wenden sich also an die betreuende berühmte russische
Klavierpädagogin, die sie für den Unterricht ihres
Schützlings haben gewinnen können und fragen sie, ob an dem
Gerücht etwas dran ist. Da die berühmte Klavierlehrerin
wirklich gut informiert und nicht von gestern ist, bestätigt sie
den Förderern unseres jungen Talents, dass das wirklich so ist.
So wird man denn gemeinsam beim führenden deutschen
Neurowissenschaftler vorstellig, um den weiteren Bildungsverlauf der
jungen Pianistin auch von dieser Seite her zu unterstützen und
ihre spätere Karriere abzusichern. Und was stellt man fest? Man
stellt natürlich fest, dass das zunehmende Training wirklich
Hirnareale, die zuvor ein wenig träge waren, aktiviert und das
es an Stellen auf den Computertomographien bunt zugeht, an denen bis
vor kurzem noch stoffwechseltechnische Ödnis herrschte. Der
betreuende Neurowissenschaftler schreibt daraufhin ein Buch mit dem
Titel: Wie das Gehirn Klavier spielen lernt.
Da
viele Mütter etwas für ihre klavierspielenden Töchter
ganz vorn an der Front des wissenschaftlich Erkennbaren tun wollen,
wird das Buch ein voller Erfolg. Und da die berühmten russischen
Klavierpädergogen nur sehr begrenzte Ausbildungskapazitäten
haben, kommt die eine oder andere Mutter auf die Idee, den
kompetenten Neurowissenschaftler zu fragen, ob er nicht die Tochter
in seinem Institut am Klavier unterrichten wolle, da er doch genau
wisse, wie das Gehirn Klavierspielen lernt. Dies ganz so, wie man von
einem Team guter Ingenieure erwarten darf, eine Produktionsstraße
wirklich auch zu bauen, in der Maschinen (sozusagen ganz seelenlos)
tadellose Mikrochips herstellen.
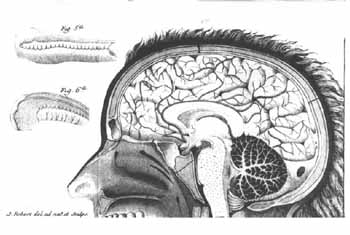
Welche Antwort würden Sie an Stelle des
Neurowissenschaftler geben?
Hier
die meine: „Ich fühle mich sehr geehrt durch die hohe
Meinung, gnädige Frau, die sie von der Qualität meines
Wissens und der sich daraus ergebenden Möglichkeiten haben.
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir gegenwärtig doch noch
nicht ganz so weit sind. Sie dürfen sich unser Wissen in Bezug
auf die Fähigkeiten des Gehirns nicht vorstellen wie
Ingenieurswissen. Gegenwärtig bestimmen wir gerade die Wirkung
der Wiederholung bestimmter Etüden wie etwa Czerny Opus 299 Nr.
7 Molto allegro auf den Lernerfolg. Mein Assistent habilitiert
diesbezüglich gerade über einige überraschende
Potentiale in der Amygdala. Die Reihenuntersuchung ist noch nicht
abgeschlossen. Aber vielleicht kann ihre begabte Tochter da ja als
Proband mitmachen. Ich muss Sie also leider einstweilen zur weiteren
Ausbildung an eine mir bekannte hervorragende russische
Klavierpädagogin verweisen. Und selbstverständlich freut
mich, dass Ihnen mein Buch gefallen hat. Sie werden auch in Zukunft
nicht auf meine Publikationstätigkeit zu verzichten haben. Mit
freundlichen Grüßen...“
Die
Seele (so wie Platon den Begriff einführt) ist das am
Menschen, was Klavierspielen kann und zwar mit dem ganzen
Ausdrucksreichtum und der Phantasie des kulturell entwickelten
Spiels. Platon hat damit einen Diskursgegenstand definiert, den die
Neurowissenschaften nicht erreichen und vielleicht – das wäre
zu fragen – auch überhaupt nicht anstreben. Oder doch?
Die
erste Frage in Sachen Psyche ist nicht, ob die Seele im Sinne
heutiger physikalistischer Vorstellungen materiell ist oder nicht,
sondern ob es einen Diskurs geben kann, der das Rätsel des
Lebendigen (Platon sagt dazu die „Seele“) sprachlich
umreißt und ausdifferenziert, ohne sich dabei auf eine
wissenschaftliche Beglaubigung stützen zu können und ob es
einen solchen Diskurs nicht nur geben kann, sondern sogar geben muss,
wenn wir uns – ungewollt – vor die Frage der Sphinx
gestellt sehen.
Die
Frage der Sphinx ist bekanntlich die Frage nach dem Menschen, nach
der Wahrheit von uns selbst. Sie nicht sinnvoll beantworten zu
können, zieht im Mythos und in so manches Menschen Leben nach
sich, von der Sphinx erwürgt und verschlungen zu werden.
Verfolgt
also Gerhard Roth mit „Wie das Gehirn die Seele macht“
die Absicht, der Sphinx antworten zu können, falls sie ihn
fragt? Da man weiß, dass die Sphinx bei Theben in den Bergen
wohnt, vermeidet man die Begegnung und macht vielleicht als
Wissenschaftler besser keinen Urlaub in Griechenland.
Die
Frage, die ich hier mit einer Figur des mythischen Denkens zuspitze,
fragt nach den Grundbedingungen von Orientierung und Wissen. Wir
neigen heute dazu, den Begriff Wissen auf das Format
empirisch-wissenschaftlichen Wissens einzuschränken, ein Wissen
um idealerweise exakt quantifizierbare Objekte der methodisch
wiederholbaren Beobachtung identischer Resultate. Dabei ist das
meiste Wissen, auf das wir im eigenen Leben zurückgreifen,
durchaus nicht von dieser Art. Unsere ganz unverzichtbaren Kenntnisse
von Personen und Beziehungen, mit denen wir leben, die meisten
unserer Orientierungen bestehen aus Wissen anderer Art, das nicht
quantifizierbar ist, sondern Qualitäten aufweist, Wissen, das
sich nur sehr beschränkt mit gleichem Ergebnis wiederholen
lässt. Hermeneutik und Phänomenologie, aber auch
Psychoanalyse versuchen, Qualitäten durch Sinngeflechte hindurch
zu verfolgen und sozusagen mit der Frage nach dem Menschen vor dessen
Objektivierung zu beginnen.
Die
Frage der Sphinx ist aber sogar noch eine Stufe brisanter und wird
dort in der Tat lebensgefährlich: Gesucht ist, was sich
zwischen Geburt und Tod bewegt. Das ist der Mensch für die
Sphinx.
Für
die Naturwissenschaften ist der Mensch etwas anderes, eine objektiv
beschreibbare Entität wie ein Stuhl oder ein Tisch, etwas, das
man nicht ist, sondern das man vor sich hat. Von dem
man grundsätzlich getrennt ist durch eine Apparatur, durch
Messschemata und Beobachtungsvorschriften. Für einen
Naturwissenschaftler ist das Leben ein Komplex quantitativ
beschreibbarer Eigenschaften des Forschungsobjekts Mensch. Der Tod
ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht ein Schicksal, sondern
Attribut eines Übergangszustands sich auflösender
Organismen.
Tod
und Leben unterscheiden sich aus naturwissenschaftlicher Sicht viel
weniger grundsätzlich voneinander als sich der Beobachter vom
beobachteten Objekt unterscheidet. Tod und Leben sind zwei
unterschiedlich beschreibbare Zustände des selben Objekts, sei
es eine Amöbe, ein Mensch oder ein Hallimasch. Viel kritischer
ist für einen Naturwissenschaftler die für ihn grundlegende
Differenz von Beobachter und Beobachteten. Diese gilt es als sicheren
Unterschied stabil zu halten, um Objektivität zu verbürgen.
Wie das gehen soll, fragt die Wissenschaftstheorie durchaus. Die
Frage „Wie macht das Gehirn die Seele“ ist zu dieser
Nachfrage ungeeignet.
Ich
möchte es noch etwas zuspitzen: Wofür braucht Platon den
Begriff Seele? Im wesentlichen, um die Differenz von Leben und Tod zu
bezeichnen. Die Seele ist für Platon das Leben selbst, das in
die Materie, den Leib hineinfährt. Und warum ist die Seele für
Platon ewig und unsterblich?
Damit
die Differenz von Leben und Tod nicht den Ort einer ständig vom
einen zum anderen oszillierenden Gefährdung markiert, sondern
einen (von Göttern) garantierten Anfangspunkt des Denkens. Es
muss Differenzen geben, von denen aus man jederzeit mit dem Denken
beginnen kann. Die Fragen nach dem Menschen: bist du lebendig oder
tot, Mann oder Frau, Vater oder Sohn? Von diesen scheint mir die
Differenz von Leben und Tod die wohl basalste (und selbstverständlich
existieren in anderen historischen Ordnungen des Denkens weitere
basale Differenzen wie eben etwa die Differenz von Beobachter und
beobachtetem Objekt).
Es wäre grundfahrlässig, das Bestehen dieser Differenz als
immer schon gesichert anzusehen, als etwas, das nicht hergestellt
werden müsste. Lebensgeschichte, Ethnologie, Psychiatrie,
Religions- und Geistesgeschichte sagen das Gegenteil. Jules Cotard
schildert 1880 den Fall einer 43-jährigen Patientin, die
glaubte, kein Gehirn zu haben und tot zu sein (Cotard-Syndrom),
weswegen sie verlangte, verbrannt zu werden. Und was, wenn das
Erleben von Leben und Tod sogar ständig wechselt wie bei solchen
Trauma-Opfern, deren Erinnerung unbeherrschbar zwischen
Abgestorbenheit und Überdeutlichkeit changiert? Haben diejenigen
Unrecht, die den schlagendsten Beweis für die Existenz der Seele
im Leiden sehen? Psychotiker
sehen sich mit der drängenden Erfahrung der Unsicherheit dieser
und anderer grundlegender Differenzen konfrontiert und die geistig
gesündesten sind es vermutlich ebenso, auch wenn es ihnen
offenbar möglich ist, damit wesentlich gelassener umzugehen. Die
Sphinx führt genau an den Ort der Herstellung dieser Differenz,
die uns die vielleicht selbstverständlichste und am wenigsten
fragwürdige von allen ist. Dies ist der Ort des Menschen, das
Leben, das um seine ewige Wahrheit
kämpft, leidlich stabil genau das nicht zu sein, wovon es
eingekreist wird: vom Tod. Und diese (ehedem von Göttern
bewachte und auch heute noch keineswegs unbewachte) ewige Wahrheit,
diese offene Flanke des Todes ist die Seele.
Uns
scheint heute zumeist der Unterschied von lebendig und tot ein völlig
triviales Faktum, das weiter nichts Großartiges sagt, keine
Grundwahrheit. Früher musste alles, was lebt, noch von einem
Gott, einer Nymphe von irgendeiner mächtigen, die Differenz
garantierenden Mythengestalt bewohnt werden. Aber wird die
metaphysische Sicherung der Differenz von Leben und Tod heute noch
gebraucht? Mit Blick auf die Naturwissenschaften scheint das nicht
mehr so zu sein. Das Leben und der Tod scheinen zu zwei
unterschiedlich komplexen Niveaus des Energieaustausches ein und
derselben Materie geworden zu sein. Und mehr nicht.
Ich
denke, wir sind heute in der Philosophie noch nicht völlig in
der Lage, abzuschätzen, was es im Hinblick auf die Frage Was
ist der Mensch hieße, wenn die Differenz Beobachter -
Objekt, schauend - angeschaut die Differenz lebendig - tot
als Leitdifferenz der Unterscheidung des Fremden vom Eigenen abgelöst
haben sollte. Wir wissen nicht einmal, ob sie das letztlich hat. Was
wir erleben, ist der quantifizierende Blick auf alle Lebensbereiche
in Wissenschaft und Ökonomie und die fortgeschrittene
Ausdifferenzierung von gegeneinander „operativ geschlossenen“
(Luhmann) Diskurssphären, die intern anderen Leitdifferenzen
folgen.
Und
wir wissen nicht genau, in wieweit wir den Gehalt des Begriff Leben
(den Sinn
von Leben), den zu bestimmen uns keineswegs dadurch leichter
wird, dass wir Synapsen und Verschaltungen kennen, überhaupt
noch benötigen, um über uns und die Polis nachzudenken.
Ihr Kommentar
Falls Sie Stellung nehmen, etwas ergänzen oder korrigieren möchten, können sie das hier gerne tun. Wir freuen uns über Ihre Nachricht.

